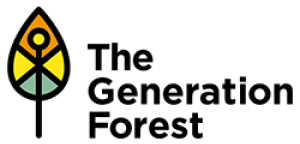Die Aufforstung von Wäldern ist ein zentraler Baustein für den globalen Klimaschutz – doch fragwürdige oder sogar betrügerische Projekte werfen immer wieder ein schlechtes Licht auf wirksame Initiativen. Die ARD-Dokumentation „Verschollen“ von Daniel Harrich, ausgestrahlt im November 2025, zeigt ein besonders drastisches Beispiel aus Brasilien: Gewaltsame Vertreibungen, zweifelhafte Landkäufe, geschönte Klimabilanzen und fragwürdige Zertifizierungen. Für viele Zuschauer:innen – und auch für uns – bleibt Fassungslosigkeit. Die Doku dokumentiert eindringlich, wie unter dem grünen Mantel des Klimaschutzes Projekte entstehen, die weder Menschen noch Natur helfen – sondern beidem schaden.
Was die Doku zeigt – und warum das kein Einzelfall ist
Die Recherchen führen in die Cerrado-Region Brasiliens, eine der artenreichsten und zugleich bedrohtesten Ökosysteme der Erde. Dort entstehen riesige Eukalyptusplantagen – finanziert über CO₂-Zertifikate und gefördert durch internationale Institutionen. Die Doku macht deutlich: Das Problem ist strukturell. Aufforstung ist vielerorts zu einem Geschäft geworden, bei dem die ökologische Komplexität eines Waldes auf Renditekennzahlen reduziert wird.
Doch es gibt Projekte, die zeigen, dass es anders geht: mit wissenschaftlichem Anspruch, sozialer Verantwortung und echter Ökologie. Weil die Doku ausschließlich die Schattenseiten zeigt, erklären wir hier anhand der kritisierten Plantage, was schlechte von guten Aufforstungsprojekten unterscheidet.
1. Plantage vs. Wald – der Kern des Problems
Das ökologische Grundproblem vieler Aufforstungsprojekte ist nicht neu. Auch in Deutschland sind Monokulturen gescheitert, etwa im Harz, wo Fichtenwald auf großer Fläche kollabiert ist. Monokulturen sind billig und effizient – aber ökologisch wertlos. Genau das zeigt die Doku: Aus der Luft wirken die Eukalyptusplantagen wie grüne Teppiche, am Boden entpuppen sie sich als ökologische Wüsten.
Plantage
- Eine Baumart, meist schnell wachsend
- Hoher Wasserbedarf
- Kaum Biodiversität
- Kurze Umtriebszeiten
- CO₂-Speicher nur temporär
Wald
- Viele Arten, unterschiedliche Altersstrukturen
- Komplexe ökologische Wechselwirkungen
- schützt Wasserkreisläufe und fördert die Bodenqualität
- Hohe Widerstandskraft gegen Klimaextreme
- Langfristiger Kohlenstoffspeicher
Eine Eukalyptusplantage mit naturnaher Waldentwicklung gleichzusetzen, ist fachlich unhaltbar. Dennoch passiert das häufig, wenn Profitinteressen dominieren und CO₂-Gutschriften auf Modellrechnungen statt auf realen Messungen beruhen.
The Generation Forest setzt auf biodiverse Generationenwälder mit bis zu 20 heimischen und seltenen Arten, die dauerhaft bestehen bleiben. Holz wird selektiv entnommen, der Wald bleibt erhalten und regeneriert sich selbst – ein zentraler Unterschied für echten Klimaschutz.
2. Keine stillen Wälder: Warum Biodiversität der beste Indikator ist
In der Doku beschreibt eine Wissenschaftlerin die Plantagen als „stille Wälder“ – ohne Vogelrufe, ohne Tiergeräusche. In unseren Wäldern ist das Gegenteil der Fall: Unsere Generationenwälder sind in kurzer Zeit Heimat zahlreicher Tierarten geworden. Kamerafallen dokumentierten bislang rund 90 verschiedene Tierarten – vom Kapuzineraffen bis zum Puma. Ein Zeichen dafür, dass funktionierende Ökosysteme entstehen. Ein Grund: Wir pflanzen vor allem dort, wo wir Waldreste verbinden können – dadurch entstehen größere, zusammenhängende Lebensräume.
3. Landgrabbing: Die stille Krise hinter vielen „grünen“ Projekten
„Verschollen“ zeigt eindrucksvoll, wie indigene Gemeinden im Cerrado unter Druck geraten, wenn große Aufforstungsunternehmen Land aufkaufen. Die Konflikte, die daraus entstehen, reichen von sozialer Verdrängung bis hin zu Gewalt. Wir positionieren uns klar solidarisch: Aufforstung darf niemals auf Kosten indigener Gemeinschaften erfolgen.
Mit The Generation Forest möchten wir es anders machen – indem wir zeigen, dass Aufforstungsprojekte von der Einbeziehung indigener Gemeinschaften profitieren. Denn für die viele Menschen ist der Wald in ihrer Heimat auch Lebensgrundlage.
“Für mich bedeutet der Wald alles. Er gibt uns Nahrung und Medizin. Unser Wunsch ist, dass unser Land eines Tages wieder vollständig mit Wald bedeckt ist – mit Wald, der einst verloren gegangen ist“, sagt zum Beispiel Juan Gonzales, der Leiter unserer Forstoperationen.
So gehen wir vor Ort mit den Flächen um:
- Wir kaufen vor allem degradierte Viehweiden und vernichten für unsere Wälder keine bestehende Natur.
- Land gehört der Genossenschaft – Spekulation ist ausgeschlossen.
- Projekte werden mit lokalen Gemeinden durchgeführt, nicht gegen sie.
2024 arbeiteten 220 Menschen in unseren panamaischen Projekten, 166 davon aus indigenen Völkern. Die Generationenwälder schaffen sichere Jobs und beweisen, dass nachhaltige Waldwirtschaft eine wirtschaftliche Alternative zur Viehzucht sein kann – gerade in Regionen, in denen Wälder sonst immer noch für Weiden gerodet werden.

Für unsere Mitgründerin Iliana Armién, die selbst aus Panama kommt, war diese Erfahrung ein Grund, um selbst aktiv zu werden gegen die Abholzung: „Ich bin als Kind mit alten Wäldern um mich herum aufgewachsen und musste mit ansehen, wie sie gerodet wurden und verschwanden. In dem Gebiet, in dem wir Generationenwälder anlegen, gab es noch vor 30 Jahren Wälder. Sie wurden abgeholzt und verbrannt, um Viehweiden daraus zu machen. Der Wald ist meine Leidenschaft und die Aufforstung von Regenwald ist meine Lebensaufgabe geworden.“
4. CO₂-Speicherung: Zwischen Versprechen und Wirklichkeit
Eine besonders schockierende Szene der Doku: Traktoren pflügen ein lebendiges Cerrado-Ökosystem um, um Platz für neue Plantagen zu schaffen. Ein klimaschädlicher Akt – legitimiert durch vermeintlichen Klimaschutz. Diese Logik hat mit Klimaschutz selbstverständlich nichts mehr gemein – das gezeigte Aufforstungsprojekt entpuppt sich spätestens hier als böse Lüge – und wirft ein schlechtes Licht auf den CO₂-Zertifikatehandel, dem es in solchen Fällen schwerfällt, offensichtlich klimaschädliche Projekte auch als solche zu benennen.
Unsere Wälder entstehen nur auf entwerteten Flächen, niemals auf Kosten bestehender Natur. Zudem gilt bei uns:
- Kein Kahlschlag, selektive Holzentnahme
- Holz bindet weiter CO₂
- entstehende Lücken werden bepflanzt oder regenerieren sich selbst
- der Wald wächst dauerhaft weiter
Dadurch bleibt CO₂ langfristig gespeichert – ein entscheidender Unterschied zur Plantagenwirtschaft. Der damalige Leiter der Umweltbehörde in Panama sagte über unser Modell in einem Interview in unserem Magazin, „dass Holznutzung ohne Schaden für das Ökosystem möglich ist und gleichzeitig der Wald langfristig wiederhergestellt wird. Es ist wichtig, dass es solche Projekte gibt, die aus eigenem Antrieb handeln und innovative Konzepte zum Erhalt des Waldes entwickeln.“
5. Transparenz: Wenn Siegel den Blick verstellen
Die Doku zeigt: Ein Zertifikat garantiert noch keine ökologische oder soziale Qualität. Viele Standards sind zu global, zu bürokratisch oder zu modellgetrieben, um die Realität im Wald tatsächlich abzubilden. Transparenz ist für uns aber kein Zertifikat, sondern eine Haltung und eine Verpflichtung gegenüber unseren Mitgliedern und Partnern. Deshalb setzen wir auf zusätzliche Maßnahmen:
- Offene Wirkungsberichte wie unseren jährlichen Impact Report
- Forschungspartnerschaften mit Universitäten
- Monitoring auf der Fläche statt am Schreibtisch
- Einblick in Mittelverwendung und langfristige Planung
Unabhängige Berichterstattung wie in der ARD-Doku kann auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen – und damit völlig zurecht zu einem Vertrauensverlust gegenüber fragwürdigen Projekten führen. Gleichzeitig kann sie aber auch Vertrauen stärken, wenn sie zeigt, wie verantwortungsvolle Aufforstung tatsächlich funktioniert.
Der ARD-Weltspiegel hat bereits 2021 über unser Projekt berichtet und unser Modell ausführlich vorgestellt – inklusive Antworten auf genau jene Fragen, die auch die aktuelle Doku „Verschollen“ aufwirft. Hier geht’s zum Weltspiegel-Beitrag:
Was die Doku nicht zeigt – aber gezeigt werden muss
Die ARD-Doku zeigt die Fehlentwicklungen eines Marktes, der sich schnell und weitgehend unreguliert internationalisiert hat. Doch sie lässt wenig Raum für Projekte, die es anders machen – und genau diesen Raum wollen wir nutzen. Die Frage sollte lauten: „Wie müssen wir aufforsten, damit Klimaschutz, Menschenrechte und Biodiversität gleichzeitig profitieren?“
Unsere Antwort ist der Generationenwald – ein Ansatz, der deutlich langsamer ist als Plantagenmodelle, deutlich aufwendiger und weniger profitorientiert. Aber er ist nachhaltig, weil er Ökologie als Grundlage begreift und nicht als Randerscheinung.
Die Doku ist ein wichtiges Warnsignal – aber kein Argument gegen Aufforstung. „Verschollen“ zeigt ein System, das droht, sich von seinen ursprünglichen Zielen zu lösen. Doch anstatt Aufforstung als Instrument grundsätzlich infrage zu stellen, sollte die Debatte anders geführt werden: Welche Modelle schaffen Klimaschutz, statt ihn zu versprechen?
Jetzt in die richtige Aufforstung investieren!