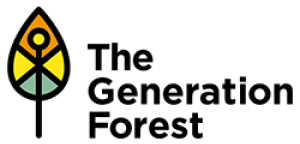Als Umweltbiologin ist Yolani Holmes den Anblick wilder Tiere gewohnt. In den Regenwäldern Panamas leben erstaunliche wie seltene Spezies, etwa das Faultier oder der Jaguar. Doch die meisten dieser Tiere bekommt selbst Yolani nicht in freier Wildbahn zu Gesicht: „Manche Tiere sind nachtaktiv, andere sind extrem scheu und immer mehr mittlerweile einfach sehr selten“, erklärt Yolani, die für die panamaische Naturschutzorganisation Ancon arbeitet. Deshalb stellt sie Kamerafallen auf, um anhand der Fotos die Biodiversität in den untersuchten Gebieten zu studieren.

Auf Waldpfaden oder kleinen Lichtungen installiert Yolani die Kameras zusammen mit den Farmerinnen und Farmern, den die Waldflächen gehören. Denn diese werden von nun an alle 20 bis 30 Tage die Speicherkarten der Kameras sammeln und den Inhalt an Yolani schicken. Um die Kameras auch an den entlegensten Positionen wiederzufinden, werden sie per GPS markiert. Wenn Yolani die Daten von den Farmen bekommt, beginnt der für sie aufregende Teil ihrer Arbeit: „Mir vorzustellen, welche Tierarten ich beim Installieren der Kameras antreffen könnte, ist schon spannend. Die wahre Belohnung kommt aber, wenn ich die Daten überprüfe und etwas Interessantes entdecke, insbesondere wenn ich feststelle, dass die Farm ein hohes Potenzial für den Schutz von Arten hat, die oft durch Abholzung gefährdet oder bedroht sind.“
Auf mehreren unserer Farmen führen Yolani und ihre Organisation Ancon diese Biodiversitätsmonitorings durch. Bereits im vergangenen Impact Report haben wir die umfangreichen Ergebnisse vorgestellt, im Jahr 2024 sind noch einige neue Spezies hinzugekommen: 25 unterschiedliche Säugetiere, 64 Vögel und ein Reptil konnten wir mithilfe der Fotofallen auf unseren Flächen identifizieren. Diese Zahlen zeigen eindrücklich, dass unsere Generationenwälder als Lebensraum von unterschiedlichen Spezies angenommen werden. Das wiederum kommt auch unseren Wäldern zugute: Denn je größer die Artenvielfalt, desto gesünder ist auch das Ökosystem.
In die Falle getappt
In unseren Generationenwäldern leben Vögel mit exotischen Namen wie der Tuberkelhokko oder der Rötelbauchmotmot. Sie fressen die Früchte von Bäumen, tragen sie weiter und scheiden sie an anderer Stelle wieder aus. Damit sind sie essenziell für die natürliche Regeneration von Wäldern. Durch den Waldverlust und die Fragmentierung von Waldflächen geht auch die Artenvielfalt zurück. Besonders betroffen sind große Vögel wie der Tukan, die laut einer jüngst in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlichten Studie der ETH Zürich nur ungern große Strecken zwischen den Waldgebieten zurücklegen.
130 Meter können für die Vögel bereits eine zu große Distanz sein, so die Forschenden der ETH. Dabei sind große Vögel bei der natürlichen Regeneration von Wäldern entscheidend: Je größer ein Baum, desto mehr Kohlenstoff kann dieser einspeichern. In der Regel haben große Bäume auch große Früchte, die wiederum nur von großen Vögeln oder manchen Affenarten gefressen werden. Verschwinden diese Arten, können sich die Bäume nicht mehr ausbreiten. Und das hat Folgen für den Klimawandel: Insgesamt gingen durch die begrenzte Bewegungsfreiheit großer Vögel 38 Prozent an potenziell speicherbarem Kohlenstoff gegenüber weniger fragmentierten Landschaften verloren, so die Erkenntnis der Studie.
Bei der Aufforstung geht also nicht nur darum, neue Waldflächen zu schaffen, sondern vor allem auch noch bestehende wieder miteinander zu verbinden. So können intakte Ökosysteme wieder zusammengeführt und die Lebensräume von Tieren erweitert werden. Bei der Aufforstung unserer Generationenwälder ist dieses Vorgehen von Anfang an ein wichtiger Bestandteil gewesen. Durch ein kontinuierliches und detailliertes Monitoring der Biodiversität gewinnen wir wertvolle Informationen, die uns beispielsweise dabei helfen, eine nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern.

Wir haben es selbst in der Hand
„Während meiner Arbeit im Bereich Biologie und Naturschutz konnte ich aus erster Hand erleben, wie alle Elemente eines Ökosystems miteinander verbunden und voneinander abhängig sind – selbst wir Menschen sind nur ein Teil dieses Puzzles“, sagt Yolani Holmes. Wir Menschen haben ohne Fragen den größten Einfluss auf die natürlichen Ökosysteme – bisher mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Der Verlust der Wälder und der Rückgang der Artenvielfalt ist eine direkte Folge der Ausbreitung des Menschen. Und das wiederum hat Folgen für uns Menschen: Natürliche Ökosysteme wie Wälder oder Moore fehlen im Kampf gegen den Klimawandel. Der Rückgang der Arten hat wiederum Folgen für uns Menschen: Der Verlust der Artenvielfalt beeinträchtigt die ökologischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Grundlagen des menschlichen Lebens und gefährdet damit langfristig unser Wohlbefinden und unsere Überlebensfähigkeit.
Doch wir haben es auch selbst in der Hand, diese Entwicklung aufzuhalten und umzukehren. Menschen wie Yolani arbeiten tagtäglich daran, unsere Umwelt und die Lebewesen um uns herum besser zu verstehen, damit wir sie besser schützen können: „Mit diesen Studien möchte ich nicht nur verstehen, wie Ökosysteme funktionieren, sondern auch wertvolle Daten und Empfehlungen liefern, die anderen Organisationen und Einzelpersonen dabei helfen können, sich für ihren Schutz einzusetzen. Ich bin der Meinung, dass meine Arbeit einen höheren Zweck hat, da sie zur Erhaltung und Bewahrung der Natur beiträgt.“
Mehr erfahren in unserem Impact Report